Lehrplan KRU konkret: Prozessbezogene Kompetenzen und „Digitales“
Nach diesem Kapitel wissen Sie, wie "religiöse Kompetenz" in der heutigen digital-medialen Welt definiert werden könnte, mit welchen konkreten unterrichtlichen Anregungen Sie Ihre SuS bei der Entwicklung der prozessbezogenen Kompetenzen des Kompetenzstrukturmodells unterstützen können und warum KI als Schnittmenge eigentlich in der Mitte des Kompetenzstrukturmodells stehen sollte. 🤓
In der Erklärung Nr. 111 Die Perspektive des Glaubens anbieten - Der Religionsunterricht in der Grundschule "beschreiben die deutschen Bischöfe die zentralen Ziele und Aufgaben des Religionsunterrichts in der Grundschule" (Quelle wie Link) und "entwerfen Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des Faches" (ebenda). Auf den Seiten 13 und 21 fordern sie Religionslehrkräfte dazu auf, den digitalen Kulturwandel auch im Religionsunterricht zu bedenken und umzusetzen. Auch Martin Rothgangel identifizierte 2021 hier unter Punkt 1.5 "Digitalisierung und ihre Herausforderungen" als ein zukunftsträchtiges Thema der Religionspädagogik. Schon das 1963 - als "moderne Kommunikationsmittel" noch Presse, Film Rundfunk und Fernsehen waren - von Papst Paul VI. promulgierte Dekret über soziale Kommunikationsmittel (Inter mirifica) plädiert dafür, dass sich die Kirche dem kompetenten Gebrauch moderner Kommunikationsmöglichkeiten stets öffnen und dies auch im RU geschehen solle (IM, Artikel 15).
Mit den bisherigen Inhalten dieser Handreichung haben Sie dafür schon ein Grundgerüst erworben. Sie haben erfahren,
- wie die digitale Transformation Gesellschaft und Menschen verändert (➡️ z. B. VUCA & Stalders Merkmale),
- über welche Kompetenzen Menschen (und Lehrkräfte und SchülerInnen 😉) verfügen sollten (➡️ z. B. 4K, 21st century skills, TPACK-Modell, Medienbildung),
- wie die curriculare Ausgangsbasis für die digital-mediale Kompetenzentwicklung im Bildungssystem aufgebaut ist (➡️ DCE-B) und
- weswegen schon in der Grundschule mit reflektiertem Medieneinsatz begonnen werden sollte
Nach diesen Basics widmen wir uns nun dem Proprium des Fachs Katholische Religionslehre und machen uns Gedanken darüber, welche konkreten inhaltlichen Auswirkungen der digitale Kulturwandel auf den Fachlehrplan Katholische Religionslehre hat.
Grundlage der nächsten 3 Kapitel ist der Fachlehrplan Grundschule Katholische Religionslehre 1-4, Ausgangspunkt dieses Kapitels sind die prozessbezogenen Kompetenzen des Kompetenzstrukturmodells des Fachlehrplans.
Die Impulse & Anregungen, die Sie in diesen Kapiteln finden, sind teilweise für die Umsetzung mit SuS und teilweise als Anregungen zum Weiterdenken für Sie gedacht. Teilweise werden Sie auch Überschneidungen zwischen den einzelnen, nicht immer trennscharf voneinander abgrenzbaren Kompetenzbereichen finden.
Vor dem Start ins Konkrete zwei elementare Punkte, die Ihr Handeln als nach dem kompetenzorientierten Lehrplan unterrichtende Lehrkraft sicherlich schon tagtäglich prägen – deren erneute Bewusstmachung jedoch hilfreich dabei ist, gewohnte Unterrichtspraktiken zu reflektieren und ggf. anzupassen, um die durch den digitalen Kulturwandel veränderten Lebenswelten und Lernprozesse mit einzubeziehen:
- Veränderte Rolle von Wissen und Lernen: Durch die schnelle Verfügbarkeit von Informationen über Suchmaschinen und Chatbots wird das (auswendig) Lernen von Faktenwissen immer unwichtiger, dafür der Prozess des Lernens immer wichtiger. Wenn Wissen jederzeit abrufbar ist, muss der Fokus also noch verstärkter auf Verstehen, Vernetzen und kritische Reflexion gelegt werden.
- Lernen als reflektierter Prozess: Lernen vollzieht sich nicht (nur) über Erfahrung, sondern auch über die Reflexion der Erfahrung. Das bedeutet, dass die Reflexion der Methoden auch beim Einsatz von digitalen Anwendungen immer wieder erfolgen sollte. Dies ermöglicht eine Sensibilisierung der Lernenden für die Chancen und Herausforderungen der jeweils verwendeten digitalen Anwendungen – ein Herzstück von Medienbildung.
Was kann der Religionsunterricht zur Medienkompetenz beitragen?
Lassen Sie uns mit einer Grafik beginnen, die zeigt, was in 1 Minute Internet global passiert:

Gewaltige Zahlen - und nun denken Sie an Ihr eigenes Nutzungsverhalten und an das, das Sie bei Ihren SchülerInnen vermuten: Welchen Anteil an diesen Zahlen haben Sie/sie? Wie gehen Sie mit der Fülle an Apps und im Internet potenziell zur Verfügung stehenden Informationen um? Sind Sie sicher, dass Sie Fake News, Deepfakes und Desinformationskampagnen erkennen, wissen Sie, welche Herausforderungen Social Media mit sich bringen?
Mit all diesen Phänomenen müssen sowohl wir als auch unsere SchülerInnen umgehen. Medienbildung hilft, „das Internet“ und seine Konsequenzen beherrschbarer zu machen, digitale Teilhabe und Selbstwirksamkeit zu verbessern und im Hinblick auf die mentale Gesundheit reflektiert mit „dem Internet“ [11] umzugehen. Dazu gehören z. B.:
- Informationskompetenz (+ Quellenkritik) zur Identifikation von Fake News und zur Bewertung qualitätsvoller Medien und Informationen
- Umgang mit der Komplexität der online potenziell zur Verfügung stehenden Informationen, z. B.: Wie recherchiere ich zielführend? Wie gehe ich mit der Unabgeschlossenheit von Informationen im Internet um, gehe effizient mit meinen Ressourcen um und "verzettle" mich nicht, indem ich von einem Link zum nächsten klicke?
- Sensibilisierung für die Notwendigkeit der richtigen Kontextualisierung, ohne den Informationen ein nur lückenhaftes oder falsches Bild der Wirklichkeit vermitteln
- Kenntnisse über Prinzipien algorithmischer Verfahren (siehe Filterblase, Zeit, die Kinder/Jugendliche/Erwachsene auf Social Media verbringen, Beauty-Filter auf Social Media)
... und dies ist nur ein Ausschnitt an Mosaiksteinchen, aus denen sich Medienkompetenz zusammensetzt - eine Querschnittsaufgabe, an der Schule (wie Sie inzwischen wissen 😉) zum Teil mitwirken kann. Unterrichtsmaterialien zur Bewältigung dieser Aufgabe gibt es zuhauf, wie z.B. hier vom ISB.
Medienkompetenz entwickelt sich jedoch nicht nur durch gezielte Thematisierung, sondern auch durch unsere Vorbildwirkung und dadurch, wie wir Medien im Unterricht einsetzen: Unsere SuS entwickeln auch dadurch ein Gespür für reflektierte Mediennutzung, indem wir qualitätsvolle Medien einsetzen und Quellen sowie mögliche Herausforderungen und Gefahren nebenbei thematisieren. Je mehr Sie über die Chancen und Herausforderungen der Apps, die Sie verwenden und die in der Lebenswelt Ihrer Schüler:innen präsent sind, informiert sind, desto gezielter können Sie nebenbei in den Unterricht einstreuen, was bei der Verwendung der jeweiligen App bedacht werden muss.
Religionspädagogisches Handeln erschöpft sich jedoch nicht in prozessbezogenen Kompetenzen, sondern richtet sich auch auf Inhalte, wie z. B. die Frage nach dem Zugang zu Gott. Dass Technik und dadurch beeinflusstes Verhalten Auswirkungen auf das Verhältnis des Menschen zu Gott und zu sich selbst hat, dürfte niemand mehr bestreiten: Angesichts zunehmender Technisierung und Algorithmisierung kann immer wieder neu über das Menschsein (aus der technischen Perspektive: über "menschliche Inkompetenz") und Gottes Zusage an uns nachgedacht werden.
Auch in Bezug auf KI könne der Religionsunterricht einen guten Beitrag dazu leisten, "um mit den Herausforderungen zurechtzukommen, die durch künstliche Intelligenz entstehen" (Quelle: Magazin "Aufbruch Künstliche Intelligenz - Was sie bedeutet und wie sie unser Leben verändert, S. 34), so Peter Dabrock, Professor für Systematische Theologie an der FAU Erlangen-Nürnberg. Er plädiert dafür, KI nicht zu verteufeln, sondern deren Weiterentwicklung zu beobachten und sich auf die neuen Möglichkeiten einzustellen.[12]
In diesem und in Kapitel 8 finden Sie deswegen eine Sammlung von Ideen zu Wechselwirkungen zwischen dem Kompetenzstrukturmodell und der digitalen Transformation. Nehmen Sie diese gerne als Ausgangsbasis für weitere Überlegungen, wie durch die digitale Transformation veränderte Praktiken in den Religionsunterricht implementiert werden könnten oder warum bereits etablierte Praktiken begründet bewahrt werden sollten. Da dem Religionsunterricht im Vergleich zum bspw. Mathematikunterricht "eine stärkere Offenheit und Unplanbarkeit des Lernprozesses inhärent ist" (Quelle: Reis/Caruso, S. 227), die gleichzeitig Kennzeichen der digitalen Transformation seien (Quelle: ebenso), könne der Religionsunterricht durch seine Verbindung mit der "existenziellen Betroffenheit der Lehrenden und Lernenden (...), dem theologischen und hermeneutischen und didaktischen Stellenwert der individuelle[n] Erfahrungen sowie der Erschließung von ´Uneindeutigkeit`" (Quelle: ebenso) für den reflektierten Einsatz neuer Praktiken besonders geeignet sein.
Bevor wir uns fragen, was genau religiöse Kompetenz in einer digital-medialen Welt bedeutet, hier noch etwas zum Lachen (oder Weinen – je nach Perspektive): Nicht einmal Papst Franziskus blieb von Deepfakes verschont!

Religiöse Kompetenz in einer mediatisierten Welt – eine Definition
„Religiöse Kompetenz in einer mediatisierten Welt“ - einer von vielen möglichen Ansätzen dargestellt auf 8 Seiten, zur leichteren und schnelleren Lesbarkeit mit Markierungen versehen: Dokument 1 auf der TaskCard.
Der Text ist entnommen aus der Dokumentation des 15. Arbeitsforums für Religionspädagogik "RU 4.0 Religiöse Bildung und Digitalisierung", das im März 2020 stattfand (abgerufen am 24.02.25).
Einfluss des digitalen Kulturwandels auf prozessbezogene Kompetenzen
Auf der UN-Konferenz zum Thema Telekommunikation, die 2022 in Bukarest stattfand, war auch eine Delegation des Vatikans vor Ort. Vatican News fasst die Position eines päpstlichen Mitarbeiters folgendermaßen zusammen: "Nachhaltigkeit, Inklusivität, Entwicklung und neue technologische Möglichkeiten, die sich an Grundprinzipien wie der Achtung des menschlichen Lebens, der Würde der Arbeit und der Sorge um das gemeinsame Haus orientieren, stellten die Herausforderung dar, bei denen der Heilige Stuhl bei der digitalen Transformation des dritten Jahrtausends eine wichtige Rolle spielen könne" (Quelle). Nicht nur der Vatikan kann dabei eine wichtige Rolle spielen – auch Sie können auf Basis Ihrer Werte Ihre SchülerInnen in ihrer Lebenswelt begleiten und positive Veränderungen bei ihnen bewirken.
Wie kann der RU beim Erwerb persönlicher Orientierungsfähigkeit und Sinnfindung helfen? Lesen Sie Anregungen dazu in einem mit h5p erstellten Buch 📘 nach, das Sie hier finden. In Blau finden Sie die Kompetenzbeschreibung aus dem LehrplanPLUS, darunter mögliche Ansätze zu deren Aufgreifen in der digitalen Transformation.
[11] Weswegen setze ich "das Internet" in Anführungszeichen? Aus zwei Gründen: 1. Oft benutze ich den Begriff der Einfachheit halber unterkomplex und meine damit Suchmaschinen, Social Media etc. gleichermaßen. 2. Jeder sieht - basierend auf seinen Nutzungsgewohnheiten und den darauf basierenden von Algorithmen vorgenommenen Berechnungen, dem Zeitpunkt der Suchanfrage, dem verwendeten Endgerät etc. - ein anderes "Internet".
[12] Ist Ihnen aufgefallen, dass das verlinkte Magazin Aufbruch eine Werbebroschüre von Google ist? Auf S. 2 ist unten in kleiner Schrift der entsprechende Vermerk zu finden ...
Lehrplan KRU konkret: Prozessbezogene Kompetenzen und „Digitales“
Nach diesem Kapitel wissen Sie, wie "religiöse Kompetenz" in der heutigen digital-medialen Welt definiert werden könnte, mit welchen konkreten unterrichtlichen Anregungen Sie Ihre SuS bei der Entwicklung der prozessbezogenen Kompetenzen des Kompetenzstrukturmodells unterstützen können und warum KI als Schnittmenge eigentlich in der Mitte des Kompetenzstrukturmodells stehen sollte. 🤓
In der Erklärung Nr. 111 Die Perspektive des Glaubens anbieten - Der Religionsunterricht in der Grundschule "beschreiben die deutschen Bischöfe die zentralen Ziele und Aufgaben des Religionsunterrichts in der Grundschule" (Quelle wie Link) und "entwerfen Perspektiven für die zukünftige Entwicklung des Faches" (ebenda). Auf den Seiten 13 und 21 fordern sie Religionslehrkräfte dazu auf, den digitalen Kulturwandel auch im Religionsunterricht zu bedenken und umzusetzen. Auch Martin Rothgangel identifizierte 2021 hier unter Punkt 1.5 "Digitalisierung und ihre Herausforderungen" als ein zukunftsträchtiges Thema der Religionspädagogik. Schon das 1963 - als "moderne Kommunikationsmittel" noch Presse, Film Rundfunk und Fernsehen waren - von Papst Paul VI. promulgierte Dekret über soziale Kommunikationsmittel (Inter mirifica) plädiert dafür, dass sich die Kirche dem kompetenten Gebrauch moderner Kommunikationsmöglichkeiten stets öffnen und dies auch im RU geschehen solle (IM, Artikel 15).
Mit den bisherigen Inhalten dieser Handreichung haben Sie dafür schon ein Grundgerüst erworben. Sie haben erfahren,
- wie die digitale Transformation Gesellschaft und Menschen verändert (➡️ z. B. VUCA & Stalders Merkmale),
- über welche Kompetenzen Menschen (und Lehrkräfte und SchülerInnen 😉) verfügen sollten (➡️ z. B. 4K, 21st century skills, TPACK-Modell, Medienbildung),
- wie die curriculare Ausgangsbasis für die digital-mediale Kompetenzentwicklung im Bildungssystem aufgebaut ist (➡️ DCE-B) und
- weswegen schon in der Grundschule mit reflektiertem Medieneinsatz begonnen werden sollte
Nach diesen Basics widmen wir uns nun dem Proprium des Fachs Katholische Religionslehre und machen uns Gedanken darüber, welche konkreten inhaltlichen Auswirkungen der digitale Kulturwandel auf den Fachlehrplan Katholische Religionslehre hat.
Grundlage der nächsten 3 Kapitel ist der Fachlehrplan Grundschule Katholische Religionslehre 1-4, Ausgangspunkt dieses Kapitels sind die prozessbezogenen Kompetenzen des Kompetenzstrukturmodells des Fachlehrplans.
Die Impulse & Anregungen, die Sie in diesen Kapiteln finden, sind teilweise für die Umsetzung mit SuS und teilweise als Anregungen zum Weiterdenken für Sie gedacht. Teilweise werden Sie auch Überschneidungen zwischen den einzelnen, nicht immer trennscharf voneinander abgrenzbaren Kompetenzbereichen finden.
Vor dem Start ins Konkrete zwei elementare Punkte, die Ihr Handeln als nach dem kompetenzorientierten Lehrplan unterrichtende Lehrkraft sicherlich schon tagtäglich prägen – deren erneute Bewusstmachung jedoch hilfreich dabei ist, gewohnte Unterrichtspraktiken zu reflektieren und ggf. anzupassen, um die durch den digitalen Kulturwandel veränderten Lebenswelten und Lernprozesse mit einzubeziehen:
- Veränderte Rolle von Wissen und Lernen: Durch die schnelle Verfügbarkeit von Informationen über Suchmaschinen und Chatbots wird das (auswendig) Lernen von Faktenwissen immer unwichtiger, dafür der Prozess des Lernens immer wichtiger. Wenn Wissen jederzeit abrufbar ist, muss der Fokus also noch verstärkter auf Verstehen, Vernetzen und kritische Reflexion gelegt werden.
- Lernen als reflektierter Prozess: Lernen vollzieht sich nicht (nur) über Erfahrung, sondern auch über die Reflexion der Erfahrung. Das bedeutet, dass die Reflexion der Methoden auch beim Einsatz von digitalen Anwendungen immer wieder erfolgen sollte. Dies ermöglicht eine Sensibilisierung der Lernenden für die Chancen und Herausforderungen der jeweils verwendeten digitalen Anwendungen – ein Herzstück von Medienbildung.
Was kann der Religionsunterricht zur Medienkompetenz beitragen?
Lassen Sie uns mit einer Grafik beginnen, die zeigt, was in 1 Minute Internet global passiert:

Gewaltige Zahlen - und nun denken Sie an Ihr eigenes Nutzungsverhalten und an das, das Sie bei Ihren SchülerInnen vermuten: Welchen Anteil an diesen Zahlen haben Sie/sie? Wie gehen Sie mit der Fülle an Apps und im Internet potenziell zur Verfügung stehenden Informationen um? Sind Sie sicher, dass Sie Fake News, Deepfakes und Desinformationskampagnen erkennen, wissen Sie, welche Herausforderungen Social Media mit sich bringen?
Mit all diesen Phänomenen müssen sowohl wir als auch unsere SchülerInnen umgehen. Medienbildung hilft, „das Internet“ und seine Konsequenzen beherrschbarer zu machen, digitale Teilhabe und Selbstwirksamkeit zu verbessern und im Hinblick auf die mentale Gesundheit reflektiert mit „dem Internet“ [11] umzugehen. Dazu gehören z. B.:
- Informationskompetenz (+ Quellenkritik) zur Identifikation von Fake News und zur Bewertung qualitätsvoller Medien und Informationen
- Umgang mit der Komplexität der online potenziell zur Verfügung stehenden Informationen, z. B.: Wie recherchiere ich zielführend? Wie gehe ich mit der Unabgeschlossenheit von Informationen im Internet um, gehe effizient mit meinen Ressourcen um und "verzettle" mich nicht, indem ich von einem Link zum nächsten klicke?
- Sensibilisierung für die Notwendigkeit der richtigen Kontextualisierung, ohne den Informationen ein nur lückenhaftes oder falsches Bild der Wirklichkeit vermitteln
- Kenntnisse über Prinzipien algorithmischer Verfahren (siehe Filterblase, Zeit, die Kinder/Jugendliche/Erwachsene auf Social Media verbringen, Beauty-Filter auf Social Media)
... und dies ist nur ein Ausschnitt an Mosaiksteinchen, aus denen sich Medienkompetenz zusammensetzt - eine Querschnittsaufgabe, an der Schule (wie Sie inzwischen wissen 😉) zum Teil mitwirken kann. Unterrichtsmaterialien zur Bewältigung dieser Aufgabe gibt es zuhauf, wie z.B. hier vom ISB.
Medienkompetenz entwickelt sich jedoch nicht nur durch gezielte Thematisierung, sondern auch durch unsere Vorbildwirkung und dadurch, wie wir Medien im Unterricht einsetzen: Unsere SuS entwickeln auch dadurch ein Gespür für reflektierte Mediennutzung, indem wir qualitätsvolle Medien einsetzen und Quellen sowie mögliche Herausforderungen und Gefahren nebenbei thematisieren. Je mehr Sie über die Chancen und Herausforderungen der Apps, die Sie verwenden und die in der Lebenswelt Ihrer Schüler:innen präsent sind, informiert sind, desto gezielter können Sie nebenbei in den Unterricht einstreuen, was bei der Verwendung der jeweiligen App bedacht werden muss.
Religionspädagogisches Handeln erschöpft sich jedoch nicht in prozessbezogenen Kompetenzen, sondern richtet sich auch auf Inhalte, wie z. B. die Frage nach dem Zugang zu Gott. Dass Technik und dadurch beeinflusstes Verhalten Auswirkungen auf das Verhältnis des Menschen zu Gott und zu sich selbst hat, dürfte niemand mehr bestreiten: Angesichts zunehmender Technisierung und Algorithmisierung kann immer wieder neu über das Menschsein (aus der technischen Perspektive: über "menschliche Inkompetenz") und Gottes Zusage an uns nachgedacht werden.
Auch in Bezug auf KI könne der Religionsunterricht einen guten Beitrag dazu leisten, "um mit den Herausforderungen zurechtzukommen, die durch künstliche Intelligenz entstehen" (Quelle: Magazin "Aufbruch Künstliche Intelligenz - Was sie bedeutet und wie sie unser Leben verändert, S. 34), so Peter Dabrock, Professor für Systematische Theologie an der FAU Erlangen-Nürnberg. Er plädiert dafür, KI nicht zu verteufeln, sondern deren Weiterentwicklung zu beobachten und sich auf die neuen Möglichkeiten einzustellen.[12]
In diesem und in Kapitel 8 finden Sie deswegen eine Sammlung von Ideen zu Wechselwirkungen zwischen dem Kompetenzstrukturmodell und der digitalen Transformation. Nehmen Sie diese gerne als Ausgangsbasis für weitere Überlegungen, wie durch die digitale Transformation veränderte Praktiken in den Religionsunterricht implementiert werden könnten oder warum bereits etablierte Praktiken begründet bewahrt werden sollten. Da dem Religionsunterricht im Vergleich zum bspw. Mathematikunterricht "eine stärkere Offenheit und Unplanbarkeit des Lernprozesses inhärent ist" (Quelle: Reis/Caruso, S. 227), die gleichzeitig Kennzeichen der digitalen Transformation seien (Quelle: ebenso), könne der Religionsunterricht durch seine Verbindung mit der "existenziellen Betroffenheit der Lehrenden und Lernenden (...), dem theologischen und hermeneutischen und didaktischen Stellenwert der individuelle[n] Erfahrungen sowie der Erschließung von ´Uneindeutigkeit`" (Quelle: ebenso) für den reflektierten Einsatz neuer Praktiken besonders geeignet sein.
Bevor wir uns fragen, was genau religiöse Kompetenz in einer digital-medialen Welt bedeutet, hier noch etwas zum Lachen (oder Weinen – je nach Perspektive): Nicht einmal Papst Franziskus blieb von Deepfakes verschont!

Religiöse Kompetenz in einer mediatisierten Welt – eine Definition
„Religiöse Kompetenz in einer mediatisierten Welt“ - einer von vielen möglichen Ansätzen dargestellt auf 8 Seiten, zur leichteren und schnelleren Lesbarkeit mit Markierungen versehen: Dokument 1 auf der TaskCard.
Der Text ist entnommen aus der Dokumentation des 15. Arbeitsforums für Religionspädagogik "RU 4.0 Religiöse Bildung und Digitalisierung", das im März 2020 stattfand (abgerufen am 24.02.25).
Einfluss des digitalen Kulturwandels auf prozessbezogene Kompetenzen
Auf der UN-Konferenz zum Thema Telekommunikation, die 2022 in Bukarest stattfand, war auch eine Delegation des Vatikans vor Ort. Vatican News fasst die Position eines päpstlichen Mitarbeiters folgendermaßen zusammen: "Nachhaltigkeit, Inklusivität, Entwicklung und neue technologische Möglichkeiten, die sich an Grundprinzipien wie der Achtung des menschlichen Lebens, der Würde der Arbeit und der Sorge um das gemeinsame Haus orientieren, stellten die Herausforderung dar, bei denen der Heilige Stuhl bei der digitalen Transformation des dritten Jahrtausends eine wichtige Rolle spielen könne" (Quelle). Nicht nur der Vatikan kann dabei eine wichtige Rolle spielen – auch Sie können auf Basis Ihrer Werte Ihre SchülerInnen in ihrer Lebenswelt begleiten und positive Veränderungen bei ihnen bewirken.
Wie kann der RU beim Erwerb persönlicher Orientierungsfähigkeit und Sinnfindung helfen? Lesen Sie Anregungen dazu in einem mit h5p erstellten Buch 📘 nach, das Sie hier finden. In Blau finden Sie die Kompetenzbeschreibung aus dem LehrplanPLUS, darunter mögliche Ansätze zu deren Aufgreifen in der digitalen Transformation.
[11] Weswegen setze ich "das Internet" in Anführungszeichen? Aus zwei Gründen: 1. Oft benutze ich den Begriff der Einfachheit halber unterkomplex und meine damit Suchmaschinen, Social Media etc. gleichermaßen. 2. Jeder sieht - basierend auf seinen Nutzungsgewohnheiten und den darauf basierenden von Algorithmen vorgenommenen Berechnungen, dem Zeitpunkt der Suchanfrage, dem verwendeten Endgerät etc. - ein anderes "Internet".
[12] Ist Ihnen aufgefallen, dass das verlinkte Magazin Aufbruch eine Werbebroschüre von Google ist? Auf S. 2 ist unten in kleiner Schrift der entsprechende Vermerk zu finden ...
Weitere Publikationen
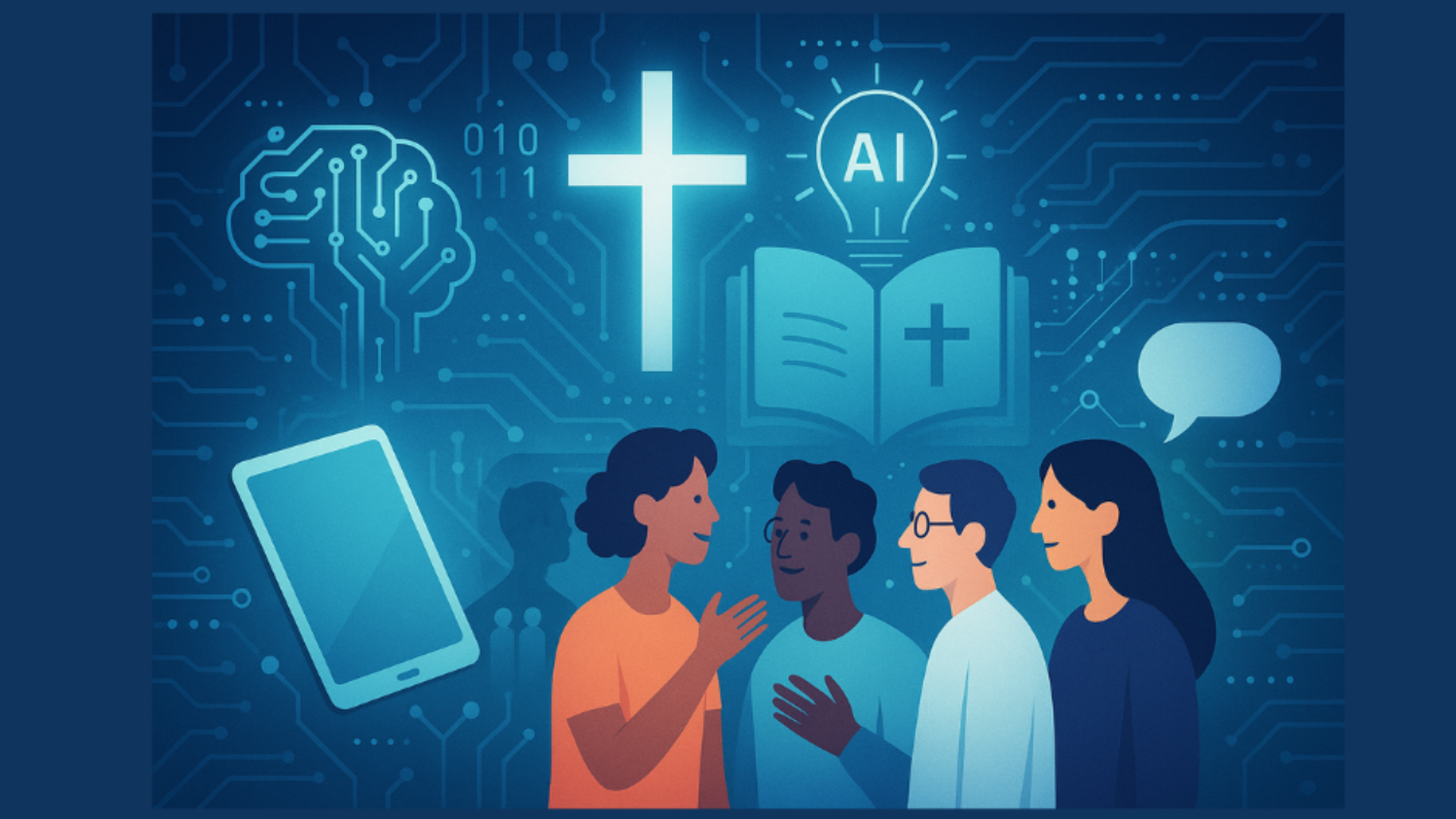
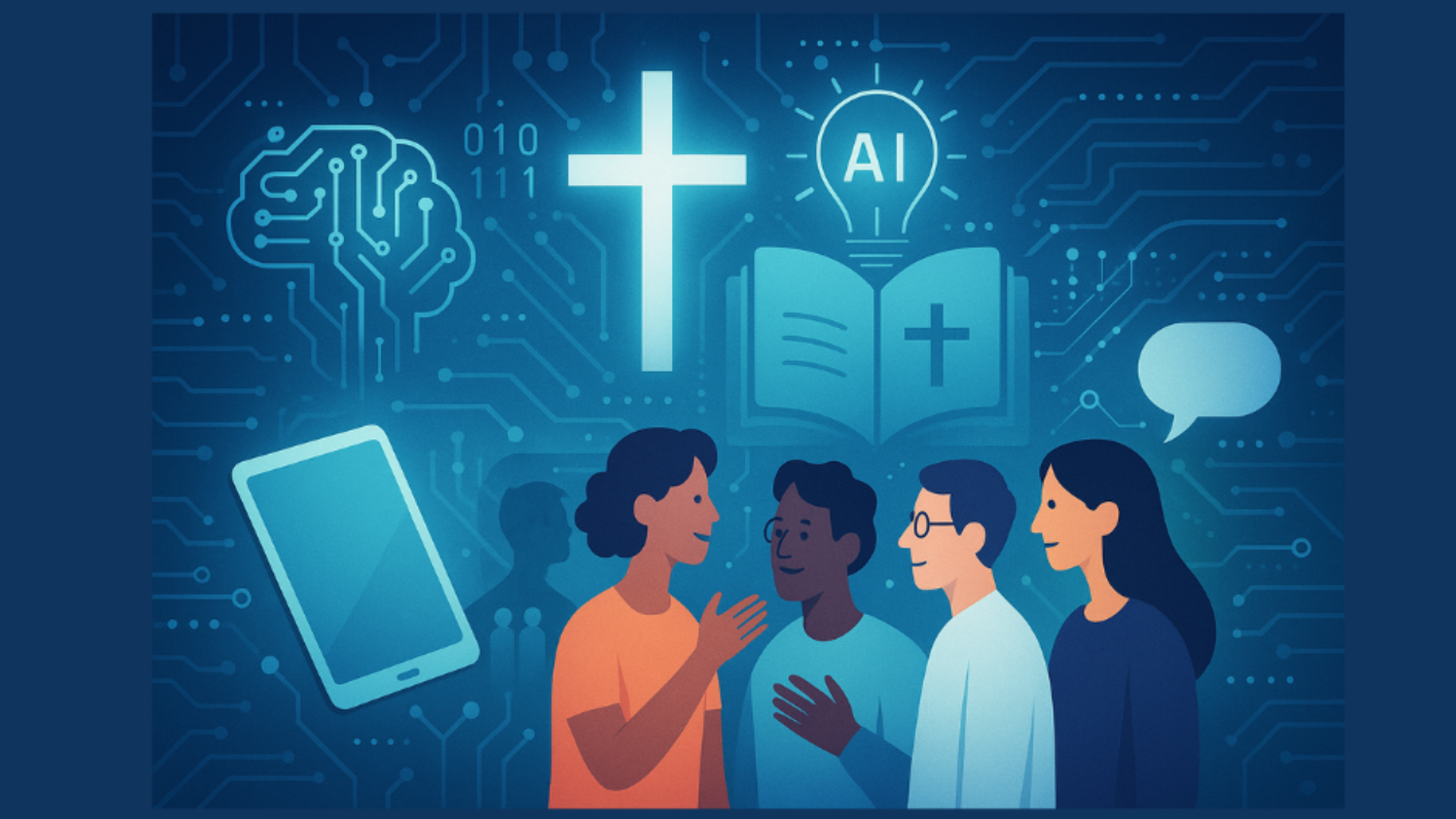
August
2025


February
2023


February
2022


January
2021
